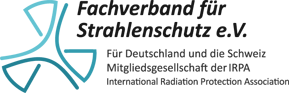Strahlung und Radioaktivität bei energietechnischen Anwendungen
Ein Resümee
Dass Energie und Strahlung unmittelbar zusammenhängen, wird niemand infrage stellen. Dass jedoch die in diesem Schwerpunktthema betrachteten sehr unterschiedlichen Energietechnologien, die in der gesellschaftlichen, mitunter emotional aufgeladenen Debatte oft gegeneinander positioniert werden, in verblüffender physikalischer Beziehung zueinanderstehen, zeigen Rainer Gellermann und Clemens Walther in ihrem Überblicksbeitrag.
Die nachfolgenden Fachbeiträge des Schwerpunktthemas verdeutlichen, dass radiologische Betrachtungen und in ihrer Folge gegebenenfalls auch Strahlenschutz-Maßnahmen im Vorfeld der eigentlichen Betriebsphase von energietechnischen Anlagen beginnen müssen und sich über den laufenden Betrieb bis zur Entsorgung von Rückständen zu erstrecken haben.
Eine wichtige Größe zur Bewertung des radiologischen Gefährdungspotenzials in einem Störfall ist das in der jeweiligen energietechnischen Anlage vorhandene und mobilisierbare radioaktive Inventar. Diesbezüglich reichen andere Technologien auch nicht annähernd an Kernspaltungsreaktoren heran oder beinhalten schlicht kein radioaktives Inventar. Allerdings versprechen neuere Kernkraft-Konzepte eine deutliche Verringerung dieses Gefährdungspotenzials. Horst-Michael Prasser erläutert, dass vor allem Reaktoren mit flüssigem Brennstoff eine gewisse Gefährdungsreduzierung mit sich bringen, da eine kontinuierliche Abtrennung von Spaltprodukten aus dem Reaktorkern während des laufenden Betriebes möglich ist. Darüber hinaus sei das Entfallen der Brennelementefertigung bei Reaktoren mit flüssigem Brennstoff ein für den Strahlenschutz wichtiger Vorteil. Andererseits stellen die Nuklidspezifika vor allem bei Schnellen Reaktoren veränderte Anforderungen an den Strahlenschutz im Vergleich zu den bisher vor allem genutzten Thermischen Reaktoren. Brutreaktoren und Blei-Wismut-gekühlte Reaktoren führen laut Horst-Michael Prasser zu mehr Alpha-Strahlern, was insbesondere an die Inkorporations- und Emissionsüberwachung erhöhte Anforderungen stellt. Eine Eigenschaft, die sowohl neue Kernspaltungs- als auch Kernfusionstechnologien im Gegensatz zu nicht nuklearen Energieanlagen aufweisen, ist die Aktivierung von Betriebskomponenten durch Neutronenbeschuss. Laut Andrew Karam erlangt vor allem bei der Kernfusion die Neutronenstrahlung eine hohe Strahlenschutz-Bedeutung. Darüber hinaus spielt das Nuklid Tritium bei Kernfusionskonzepten eine herausragende Rolle.
Ähnlich wie beim Anlageninventar verhält es sich auch mit den radioaktiven Reststoffen und Abfällen. Die kerntechnischen Energieanlagen führen zum weitaus größten und radiologisch am meisten relevanten Anteil der zur Entsorgung anstehenden Stoffe. Allerdings versprechen einige neue Reaktorkonzepte (Thorium-Reaktoren, Schnelle Reaktoren) eine Reduzierung der erforderlichen Zeitspanne, in welcher die Sicherheit eines Endlagers gewährleistet werden muss. Mehr noch, sie können neuen Brennstoff „erbrüten“ und damit auch die Menge von endzulagernden, hochradioaktiven Abfällen reduzieren.
Bei der Beschaffung der für die jeweilige Technologie erforderlichen Rohstoffe, welche vornehmlich aus geologischen Formationen erfolgt, werden natürlich-radioaktive Materialien aus der Geosphäre in die Biosphäre befördert. Durch die wesentlich bessere Ausnutzung des Kernbrennstoffs bei neuen Generationen von Kernkraftwerken wird eine drastische Senkung des Aufwands für deren bergbauliche Gewinnung erreicht.
Die Frage, welche geogenen Radioaktivitätsmengen in die energietechnischen Anwendungen und damit in die Biosphäre gelangen können, ist bei der Nutzung fossiler Energieträger keine neue Fragestellung. Klaus Flesch diskutiert die entsprechenden Zahlen und Schlussfolgerungen bei der Nutzung von Erdöl und Erdgas. Ähnliche Betrachtungen wurden schon in Heft 1/2017 der StrahlenschutzPRAXIS bezüglich der Braunkohleverstromung angestellt.
Die Aufgabe, Batterien und Speicher für die Elektromobilität und für die Pufferung der stark schwankenden Erneuerbaren in einer bisher nicht gekannten Größenordnung zur Verfügung zu stellen, führt zu neuen Fragen für den Strahlenschutz. Mark Sonter, Nick Chambers und Rainer Gellermann weisen in ihrem Beitrag darauf hin, dass in den Gesteinen, aus denen Lithium gewonnen wird, auch Uran vorkommt. Bei der chemischen Abtrennung des Lithiums können das Uran und seine Zerfallsprodukte angereichert werden. Ein sehr besonderer Fall ist die Lithium-Gewinnung aus salinaren Thermalwässern, bei der die bekannten Anlagenkontaminationen der Geothermie zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang sei auf den Überblick zu Strahlenschutzfragen bei der Tiefengeothermie in Heft 3/2014 hingewiesen.
Dass beachtliche Strahlenexpositionen bei der bergbaulichen Gewinnung von Seltenen Erden auftreten, die u. a. für Wind- und Solarenergie-Anlagen unabdingbar sind, verdeutlichen Simon Bittner, Rainer Gellermann und Clemens Walther in ihrem Artikel „Der strahlende Schatten der Windenergie“. Mit dem Lithiumbergbau und der Gewinnung von Seltenen Erden haben selbst die sogenannten erneuerbaren Energietechnologien, die gern als positiver Gegenpart zu nuklearen und fossilen Technologien angesehen werden, bei Betrachtung des gesamten „Lebenszyklus“ eine nicht zu vernachlässigende radiologische Relevanz. Höchst interessant ist deshalb der Vergleich von Bevölkerungs-Kollektivdosen bei den Rohstoffbeschaffungstechnologien, den die Autoren für Expositionen anstellen, die auf die im Anlagenbetrieb generierte Energiemenge bezogen sind. Hierbei verzeichnen Wind- und Solarenergie die zweitschlechteste Bilanz hinter der Kohleenergie und noch vor nukleartechnischen Einrichtungen. Schlussfolgernd ist für dieses Schwerpunktthema festzuhalten, dass für die Vergabe von radiologischen Pro- und Kontra-Prädikaten an Energietechnologien auch und vor allem die bergbauliche Gewinnung der Rohstoffe und deren Aufbereitung im Vorfeld des eigentlichen Stromerzeugungsprozesses zu betrachten sind. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass bei der Vielfalt, bei der Unterschiedlichkeit, aber auch bei der Entwicklungsdynamik der Technologievarianten ein solcher radiologischer Vergleich nur ansatzweise, aber nicht allumfassend möglich war. Nichtsdestotrotz kann eine vergleichende, wissenschaftsbasierte Vorgehensweise dazu beitragen, den gesellschaftlichen Diskussionen ihre emotionale Komponente zu nehmen.
Hartmut Schulze